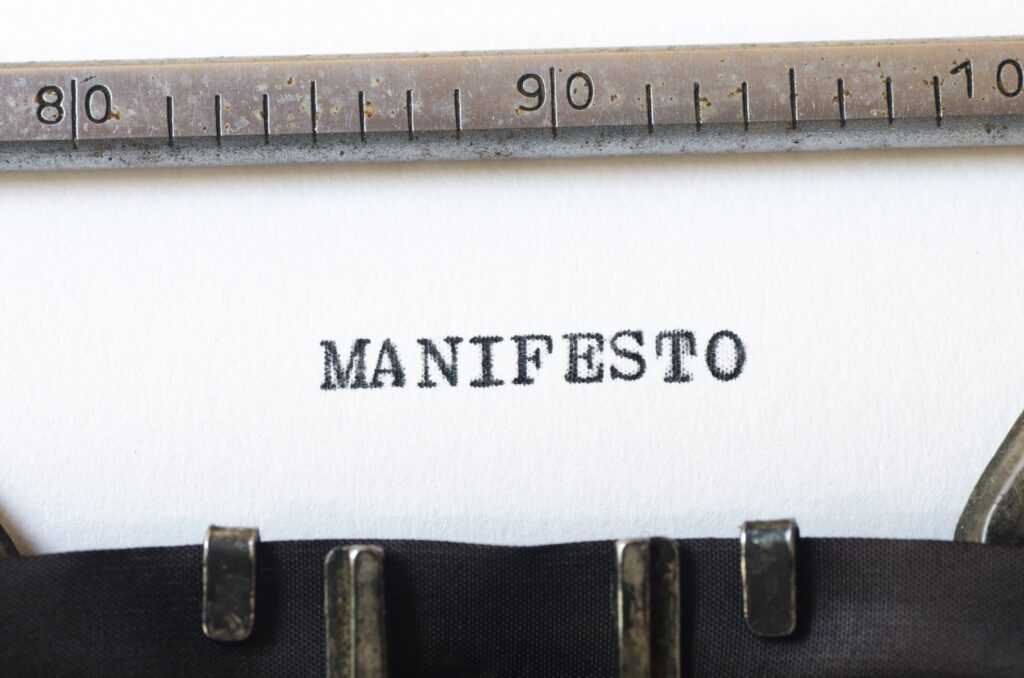© AdobeStock
Autor: Tilo Fuchs, 14.07.2025
Der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierungskoalition ist nicht der erste, der sich an vielen Stellen dazu bekennt, die Bedingungen für Start-Ups verbessern zu wollen. Mal geht es um eine allgemeine Verbesserung der wirtschaftlichen und steuerlichen Bedingungen, mal um weniger Bürokratie, mal um die Verbesserung der Bedingungen für Investoren und Venture Capital, mal um bestimmte Branchen wie Verteidigung, KI, Gesundheit oder Energietechnik, die politisch als besonders dringend erkannt wurden.
Hintergrund dieser vielgestaltigen politischen Handlungspläne ist eine immer wieder gehörte Diagnose: Seit SAP – also seit 1972! – ist es in Deutschland niemanden mehr gelungen, eine neue technische Entwicklung aufzugreifen und mit stetig neuen Produkten und Lösungen daraus einen Weltkonzern zu formen und zu etablieren. Auch wenn dieser Blick vielleicht etwas zu eng ist und auch wenn innovative Mittelständler auf ihren spezifischen Gebieten als hidden champions den Takt in der Welt vorgeben, stimmt doch die grundlegende Analyse: Die globalen Marktführer der Internet-Ökonomie stammen ebenso aus anderen Ländern wie diejenigen Unternehmen, die eine neue Generation von Technologien entwickeln, in denen Deutschland einmal ganz vorne mitspielte – neue Kraftwerkstechnologie, neue Auto-Technik, Maschinenbau für die Chipproduktion.
Ein Mangel an guten Ideen oder an Menschen, die gute Ideen haben, kann nicht die Erklärung hierfür sein. Auch an Kapital fehlt es nicht, wenn es auch sicher einiges an Handlungsbedarf gibt, um seine Besitzer leichter die größeren Risiken des Investierens in Innovationen eingehen zu lassen. Woher also der Mangel an deutschen Einhörnern?
Ein wichtiger Unterschied zu anderen Märkten, insbesondere zu den USA, ist im Bereich der Bürokratie und Regulierung zu suchen. Auch in den USA gibt es ein komplexes Gewebe an staatlicher Rahmensetzung, es geht also nicht ausschließlich um viel oder wenig Regulierung – relevant scheint insbesondere der Umgang damit zu sein. Neue Geschäftsmodelle treffen jenseits des Atlantiks auf mehr Offenheit, und wo gesetzliche Regelungen Veränderungen erschweren, scheinen sowohl politische Entscheider wie auch die Unternehmen selbst dies als lösbares Problem zu empfinden. In Deutschland hört man von beiden Seiten dagegen allzu oft: „Das ist nicht erlaubt, also dürft ihr das nicht machen“ bzw. „…also können wir das nicht machen“ – Regulierung wird als eherne Regel empfunden, nicht als adaptives System, das jeweils neue Entwicklungen aufnehmen kann und aufnehmen sollte.
Das Ziel von Regulierung ist aber genau das: Unter sich wandelnden Voraussetzungen dafür zu sorgen, dass gesellschaftlich geteilte Werte und Ziele abgesichert werden. In einer innovativen Wirtschaft bedeutet das auch eine Notwendigkeit, Regulierung ständig anzupassen. Genauso wie grundsätzliche Abschottung gegen Neues die falsche Haltung aufseiten des Regulierers ist, so ist Frustration die falsche Reaktion, wenn man selbst ein neues Geschäftsmodell oder eine Innovation mit einem neuen Unternehmen groß machen will.
Die bessere Antwort lautet: Öffnung und Engagement, aktive Gestaltung statt Scheitern am Hergebrachten. Für jedes Start-Up ist die Frage nach dem regulatorischen Rahmen letztlich genauso wichtig wie die Suche nach Kapital, nach den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder nach der richtigen Vermarktungsstrategie. Ein allgemeines Weniger an Bürokratie mag den Prozess des Gründens und die Unternehmensführung erleichtern, aber es wird kaum jemals dazu führen, dass spezifische Hindernisse für das eigene innovative Geschäftsmodell, die Veränderung von Richtlinien und Förderprogrammen spontan entstehen. Die regulatorischen Umweltbedingungen zu schaffen, damit das eigene Unternehmen nicht Idee bleibt, sondern Einhorn werden kann, ist eine Arbeitsaufgabe.
Unsere Erfahrung zeigt: Auch junge Unternehmen oder Gruppen von Start-Ups treffen in der Politik auf offene Ohren und tätige Unterstützung, wenn sie ihre Anliegen politisch anschlussfähig vorbringen und Lösungsvorschläge machen, die mit den politischen Leitlinien der Entscheiderinnen und Entscheider kompatibel sind. Politik ist nicht immer in der Lage von alleine zu erkennen, welcher Halbsatz einer Verordnung oder welcher blinde Fleck in einem Gesetz einer neuen Idee im Wege steht. Aber sie ist sehr wohl willens und in der Lage, solche Hindernisse zu beseitigen, wenn die Entscheiderinnen und Entscheider konkrete, in ihrem Handlungsfeld umsetzbare Wege aufgezeigt bekommen.
ALP hat zahlreiche Start-Ups erfolgreich dabei unterstützt, regulatorischen Raum für ihr Geschäftsmodell zu schaffen, sowohl die spezifischen Einzelfragen eines Unternehmens wie auch die gemeinsamen Anliegen mehrerer Unternehmen eines neuen Geschäftszweigs. Gerade jungen Unternehmen fehlen meist Zeit und passende Personen im eigenen Haus, um die regulatorischen und politischen Anforderungen zu bearbeiten. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot, uns um diese zentrale Dimension des Erfolges zu kümmern.